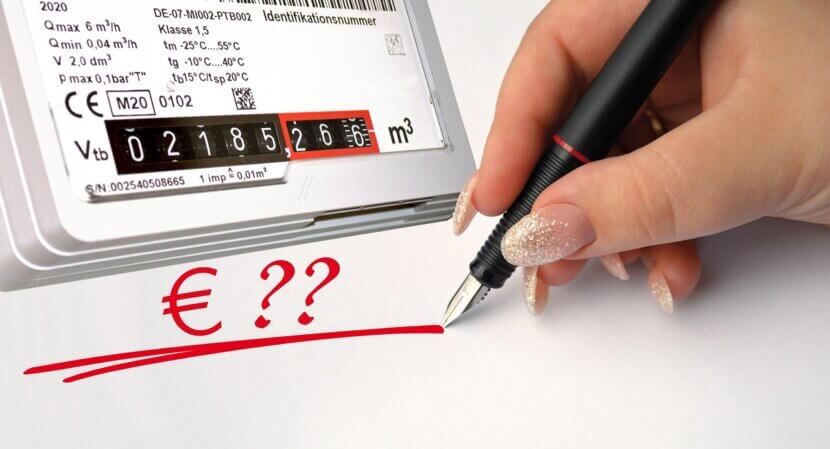Mietern und Wohnungseigentümern, die an eine gemeinsame Versorgungsanlage angeschlossen sind, flattert einmal pro Jahr nicht nur die Betriebskosten-, sondern auch die Heizkostenabrechnung ins Haus. Was es in diesem Zusammenhang mit dem Heiz- und Kältekostenabrechnungsgesetz (HeizKG) auf sich hat, weiß AK-Wohnrechtsexperte Clemens Berger.
Wann gilt das HeizKG?
Eine Heizkostenabrechnung nach dem HeizKG erhalten all jene Mieter sowie Wohnungseigentümer, deren Wohnung nicht mittels Einzelheizung, sondern von einer gemeinsamen Versorgungsanlage geheizt, gekühlt und/oder mit Warmwasser versorgt wird. Mieter von Wohnungseigentümern erhalten die Abrechnung nach dem HeizKG nur dann, wenn der sogenannte Abgeber, also derjenige, der zur Abrechnung verpflichtet ist, vom Mietverhältnis in Kenntnis gesetzt wurde. Außerdem müssen von der gemeinsamen Versorgungsanlage zumindest vier Nutzungsobjekte, also Wohnungen beziehungsweise Wohnungen und Büros oder Geschäfte, versorgt und der Verbrauch gemessen werden. „In diesem Fall müssen natürlich die Kosten aufgeteilt werden“, sagt Clemens Berger, Wohnrechtsexperte der AK Wien. Eine Verpflichtung zur verbrauchsabhängigen Abrechnung besteht dort, wo die Messung (über Messvorrichtungen oder Heizkostenverteiler) des Verbrauches technisch und wirtschaftlich machbar ist. Andernfalls wird unabhängig vom Verbrauch nach Nutzflächen oder Nutzwerten aufgeteilt.
Was bedeutet Einzelheizung?
Sorgen eine Gastherme oder ein Stromboiler in der eigenen Wohnung für Warmwasser und Wärme, handelt es sich dabei um eine Einzelheizung. Das HeizKG kommt hier nicht zur Anwendung. In diesem Fall erfolgt die Abrechnung auf Basis des jeweiligen Vertrages mit dem Gas- beziehungsweise Stromlieferanten. Man spricht von einer Tarifabrechnung, bei der nur die Kosten für den Verbrauch in der Wohnung abgerechnet werden.
Was ist eine „gemeinsame Versorgungsanlage“?
Unter einer „gemeinsamen Versorgungsanlage“ ist eine Zentralheizung und/oder zentrale Kälteversorgungsanlage im Gebäude oder eine Fernwärme- beziehungsweise Fernkälteversorgung zu verstehen. In diesem Fall kommt es zu einer sogenannten Verteilabrechnung, bei der die einzelnen Abnehmer nicht ihren eigenen Verbrauch, sondern einen Anteil an den Versorgungskosten des gesamten Hauses übernehmen (inklusive Leitungsverluste).
Wer ist Wärme-/Kälteabgeber, wer Wärme-/Kälteabnehmer?
Diesen beiden Begriffen kommt im HeizKG eine zentrale Bedeutung zu, weil die Abrechnung ja vom Abgeber an den Abnehmer zu übermitteln ist, so Berger. Abgeber ist derjenige, der eine gemeinsame Versorgungsanlage im eigenen Namen betreibt und Wärme oder Kälte unmittelbar an die Abnehmer weiter gibt. Auch derjenige, der die Wärme beziehungsweise Kälte vom Erzeuger übernimmt, um diese im eigenen Namen an die Abnehmer weitergeben, ist Abgeber. Das trifft beispielsweise auf den Gebäudeeigentümer zu, der die Fernwärme an der Übergabestation übernimmt und im Gebäude für die Versorgung der einzelnen Wohnungen zuständig ist. Als Wärme-/Kälteabnehmer gelten zum einen Eigentümer oder Fruchtnießer des Gebäudes, zum anderen Wohnungseigentümer. Auch Mieter in einem Zinshaus oder dem Gebäude einer gemeinnützigen Bauvereinigung gelten laut HeizKG als Abnehmer, da sich ihr Benützungsrecht unmittelbar vom Eigentümer oder Fruchtnießer des Gebäudes ableitet.
Anders sieht es bei Mietern von Eigentumswohnungen aus: Sie leiten ihr Mietrecht ja vom Eigentümer einer Wohnung, aber nicht vom (Mit)Eigentümer des gesamten Gebäudes ab und sind daher keine Wärme-/Kälteabnehmer im Sinne des HeizKG. Allerdings werden sie Abnehmern in Bezug auf die Heizkostenabrechnung gleichgestellt, sofern der Abgeber über das Mietverhältnis in Kenntnis gesetzt wurde.
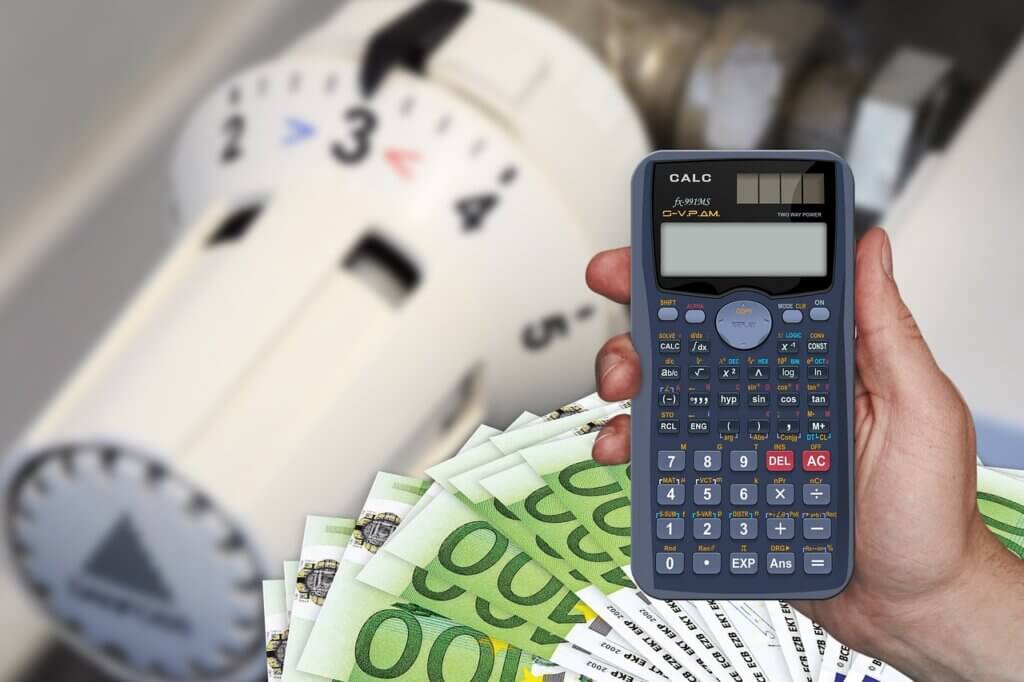
Welche Kosten dürfen nach HeizKG abgerechnet werden?
„Prinzipiell dürfen bei Heizungen, die dem HeizKG unterliegen, Energiekosten und sonstige Kosten des Betriebs verteilt werden. Das sind einerseits die Kosten der Energieträger für die Wärme- und Kälteerzeugung sowie den Betrieb der Versorgungsanlage, andererseits die Kosten der Betreuung und Wartung der Anlage sowie jene für Ablesung und Abrechnung“, sagt Berger. Nicht nach dem HeizKG verrechnet werden dürfen die Kosten für die Anschaffung und Erhaltung der Wärmeversorgungsanlage. Ausnahmebestimmungen gibt es aber für Fernwärme und fernwärmeähnliche Anlagen.
Wie werden die Kosten bei der Heizkostenabrechnung aufgeteilt?
Die Verrechnung der Kosten erfolgt zum überwiegenden Teil verbrauchsabhängig, der Rest wird nach versorgbarer Nutzfläche aufgeteilt. Welcher Verteilungsschlüssel für die Kosten gewählt wird, kann durch Vereinbarung zwischen dem Abgeber und sämtlichen Abnehmern festgelegt werden – er muss jedoch innerhalb der gesetzlich festgelegten Spanne liegen. Ohne entsprechende Vereinbarung werden die Energiekosten zu 70 Prozent verbrauchs- und zu 30 Prozent verbrauchsunabhängig aufgeteilt. „Kann der Verbrauch nicht abgelesen werden, beispielsweise, weil der Ableser nicht in die Wohnung konnte oder ein Zähler ausgefallen ist, kann der Verbrauch mittels Hochrechnung ermittelt werden“, erklärt Berger.
Wann bekommt man die Heizkostenabrechnung?
Im HeizKG wurde dazu kein bestimmter Stichtag festgelegt. „Die Abrechnungsperiode dauert in der Regel zwölf Monate. Danach muss der Abgeber abrechnen und den Abnehmern binnen sechs Monaten schriftlich eine Abrechnungsübersicht zukommen lassen“, sagt Berger.
Für diese hat der Gesetzgeber einige Vorgaben festgelegt: Die Abrechnungsübersicht muss unter anderem übersichtlich sein, den Beginn und das Ende der Abrechnungsperiode, die Menge der Energieträger und den Verbrauchsanteil des Nutzungsobjektes, etwaige Überschüsse, aber auch den Hinweis, dass die Abnehmer innerhalb des darauffolgenden Monats Einsicht in die vollständige Abrechnung sowie die Belegsammlung nehmen können, enthalten. Wird keine Abrechnung gelegt, oder keine Einsicht in die Belege gewährt, können Abnehmer das im Verfahren vor der Schlichtungsstelle oder dem Bezirksgericht durchsetzen.
Was tun bei Zweifeln an der Heizkostenabrechnung?
Abnehmer können innerhalb von sechs Monaten nach Rechnungslegung schriftlich begründete Einwände gegenüber dem Wärmeabgeber erheben. „Wird das nicht gemacht oder die Frist versäumt, dann gilt die Abrechnung als genehmigt“, so Berger. Erfolgt der Einspruch rechtzeitig, kann binnen drei Jahren ab Legung der Abrechnung ein Verfahren zur Prüfung der inhaltlichen Richtigkeit eingeleitet werden.
Was passiert mit Überschüssen oder Nachzahlungen?
Ergibt sich aus der Abrechnung ein Guthaben für Mieter oder Eigentümer, muss dieses vom Abgeber innerhalb von zwei Monaten ab der Abrechnung rückerstattet werden. Flattert eine Nachzahlung ins Haus, muss diese ebenfalls innerhalb von zwei Monaten beglichen werden. Allerdings: Der Abgeber muss etwaige Nachforderungen binnen eines Jahres nach Ablauf der jeweiligen Abrechnungsperiode geltend machen. Danach müssen sie vom Mieter oder Eigentümer nicht mehr beglichen werden.
Und Achtung: Das HeizKG regelt ausschließlich, welcher Anteil der Heizkosten einem bestimmten Nutzungsobjekt zugeordnet wird. Nur weil ein Mieter eine nach dem HeizKG richtige Abrechnung bekommt, heißt das nicht, dass der die Kosten auch 1:1 bezahlen muss. Was nämlich wirklich zu bezahlen ist, das regelt der Mietvertrag beziehungsweise das Wohnrecht. Deshalb zahlen Wohnungseigentümer auch Reparaturen an der Wärmeversorgungsanlage, obwohl diese in der Abrechnung nach HeizKG nicht ausgewiesen werden dürfen.
Unser Experte

Ähnliche Beiträge:
Betriebskosten: Was Mieter & Eigentümer wissen sollten