Er gilt als ältester Baustoff Mitteleuropas – und als einer der modernsten zugleich: Lehm. In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit zur Voraussetzung geworden ist, erlebt bauen mit Lehm eine glanzvolle Renaissance. Der Forscher und Entwickler Roland Meingast von der Firma Lopas erklärt, warum Lehm nicht nur ökologisch überzeugt, sondern auch das Raumklima verwandelt.
Lehm war nie verschwunden. Aber er stand jahrzehntelang im Schatten von Beton, Ziegel und Stahl. „In den letzten zwei bis drei Jahren ist das Interesse explodiert“, erzählt Roland Meingast. „Die Hörsäle auf den Unis sind voll, die Nachfrage wächst.“ Dabei begann die Wiederentdeckung bereits vor rund 40 Jahren – im Zuge der ersten Umweltdiskussionen. Heute, in einer Welt, die CO₂-Bilanzen misst und nach klimafreundlichen Lösungen sucht, rückt der Baustoff in die erste Reihe.
Die Geschichte des Lehms ist dabei ebenso alt wie die Architektur selbst: Die ersten Häuser Mitteleuropas wurden aus Lehm gebaut, im Weinviertel war er bis 1850 fast durchgängig das verwendete Baumaterial. Vieles ist noch erhalten, sofern es nicht abgerissen wurde. Langlebigkeit ist also kein Versprechen, sondern historisch belegt.
Natürliches Raumklima – Luxus, den man spürt
Die vielleicht beeindruckendste Stärke von Lehm ist seine Wirkung auf das Raumklima. „Lehm hat extrem viele Vorteile“, sagt der Niederösterreicher. Der wichtigste: der Ausgleich der Luftfeuchte. Ein Bad mit Lehmputz kennt keinen beschlagenen Spiegel, weil die Wände überschüssige Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
Darüber hinaus wirkt Lehm wie eine natürliche Klimaanlage. Seine massive Speichermasse nimmt in der Nacht Kühle auf und gibt sie tagsüber langsam ab. Räume bleiben frisch, auch wenn draußen die Hitze steht – ein sanfter Temperaturausgleich, ganz ohne Technik.
Und es gibt noch einen Effekt, der fast geheimnisvoll klingt: In einem 320 Quadratmeter großen Forschungsgebäude komplett mit Lehm ausgebaut, wurde die Luftqualität gemessen. Drinnen war die Konzentration negativer Luftionen doppelt so hoch wie draußen. Diese winzigen Teilchen gelten in der Medizin als förderlich für Konzentration und Wohlbefinden. „Vielleicht ist das der Grund, warum man sich in Lehmbauten so außergewöhnlich wohlfühlt“, vermutet Meingast.

Sicher und beständig – seit Jahrhunderten
Wer Lehm aktuell mit bröckeligen Häusern in fernen Erdbebengebieten verbindet, irrt. „Es kommt auf die Bauweise an“, betont Meingast. Historische Holz-Lehm-Fachwerke haben nachweislich schwere Beben überstanden, weil die Verbindung von Holz, Lehm und Stroh elastisch ist und Energie absorbiert. Genau diese Kombination gilt heute als besonders widerstandsfähig – und als eine der nachhaltigsten Bauweisen überhaupt.
Auch ohne Katastrophen beweist Lehm seine Stärke: „Ich kenne Proben von 1600, die heute noch stabil sind.“ Risse entstehen höchstens bei Verarbeitungsfehlern in den ersten Tagen, danach hält der Putz praktisch unbegrenzt – solange das Gebäude selbst intakt bleibt.
Bauen mit Lehm in Rekordzeit
Wer bei Lehm an mühsames Stampfen und langsames Trocknen denkt, liegt falsch. Moderne Lehmbauten entstehen auch mit industriell gefertigten Elementen. Wände aus Holz und Stroh, die im Werk mit Lehm beschichtet werden, lassen sich binnen weniger Tage montieren. „Ein Einfamilienhaus steht in drei bis vier Tagen, dann folgt der Innenausbau“, erklärt Meingast. So lassen sich Bauzeitverzögerungen vermeiden, die früher durch das langsame Trocknen problematisch waren.
Seit 2013 garantiert zudem eine eigene DIN-Norm die Qualität von Lehmprodukten: Sie definiert die Mischungen, verbietet chemische Zusätze und macht Lehm zu einem geprüften, klar regulierten Baustoff.

Kosten und Lebensdauer von Lehm – eine lohnende Rechnung
Die Lehmbauweise ist etwas teurer als der Standard. „Fünf bis zehn Prozent mehr als herkömmlicher Hausbau“, so Meingast. Doch er relativiert sofort: „Die Mehrkosten stehen in keinem Verhältnis zu dem, was man gewinnt – an Raumklima, an der Gesundheit und an der Langlebigkeit.“ Wer mit Lehm baut, investiert also in Jahrhunderte – und nicht nur in ein einzelnes Leben.
Lehm – ein Stoff, der nicht ausgeht
Während Sand und Zement knapper werden, ist Lehm im Überfluss vorhanden. „Im Weinviertel gibt es bis zu 600 Meter dicke Schichten“, erzählt Meingast. In der Slowakei verarbeitet er Aushublehm aus einem Bergwerk – geprüft und normiert. Tatsächlich ist Lehm das einzige Material, mit dem sich, so Meingast, „die gesamte Weltbevölkerung mit menschenwürdigem Wohnraum versorgen ließe“.
Politik statt Werbung
Ob Lehm in zehn Jahren selbstverständlich sein wird, hängt nicht allein von Bauherren oder Architekten ab. „Das ist keine Frage der Werbung, sondern der Politik“, sagt Meingast. „Wenn CO₂-Kosten, Ressourcenschonung und Rückbaukosten ehrlich in die Preise eingerechnet werden, dann hat Lehm die größte Chance.“ Denn technisch ist fast alles möglich: vom Einfamilienhaus bis zum fünfgeschossigen Neubau.
Vorteile von Bauen mit Lehm im Überblick
- Feuchtepuffer: Reguliert Luftfeuchtigkeit, verhindert beschlagene Spiegel.
- Natürliche Klimaanlage: Kühlt durch Speichermasse und Verdunstung.
- Luftioneneffekt: Katalysatoreffekt für negative Luftionen im Innenraum, fördert das Wohlbefinden.
- Sicherheit: Holz-Lehm-Stroh-Konstruktionen sind elastisch und widerstandsfähig.
- Nachhaltigkeit: Vollständig mineralisch, ohne Chemie, unendlich oft wiederverwendbar.
- Lebensdauer: Hält Jahrhunderte – Lehmputze aus 1600 sind noch intakt.
- Bauzeit: Einfamilienhaus in 3–4 Tagen montierbar.
- Kosten: 5–10 % teurer, aber gesundheitlich und ökologisch überlegen.
Unser Experte
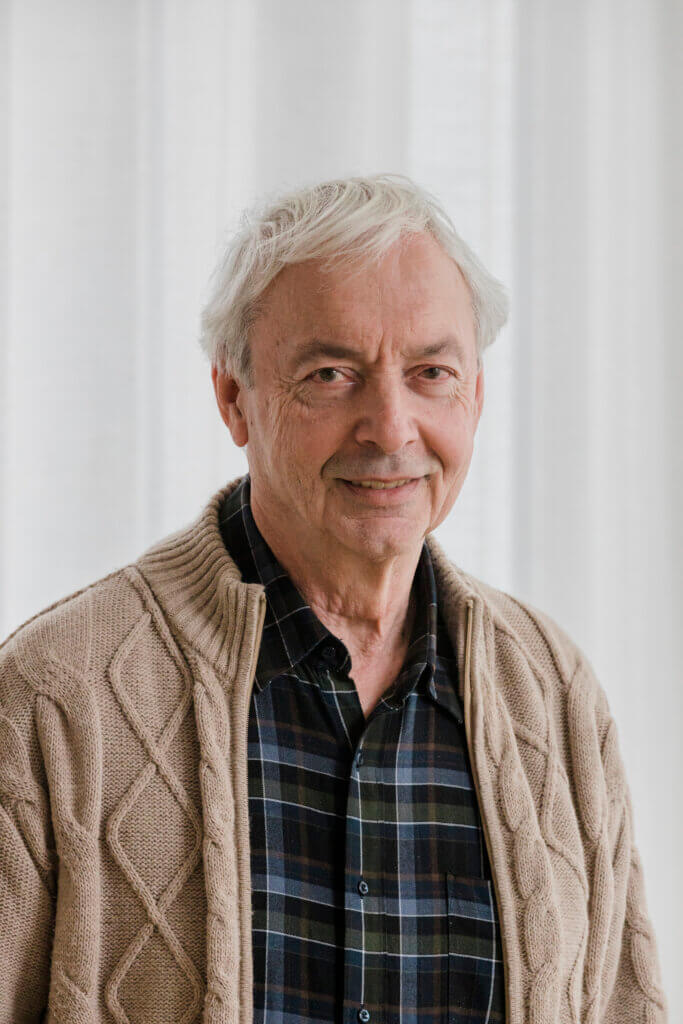
Roland Meingast ist Techniker, Forscher und Entwickler bei der Wiener Firma Lopas GmbH mit Schwerpunkt auf nachhaltiges Bauen mit Lehm, Holz und Stroh. Seit den 1990er-Jahren treibt er die Entwicklung moderner Fertigsysteme voran und gilt als einer der Pioniere des zeitgenössischen Lehmbaus in Österreich.
Website: www.lopas.at
Fotos: Lopas
Ähnliche Beiträge:
Projekt Hausbau – was Sie wissen sollten inkl. Checkliste













