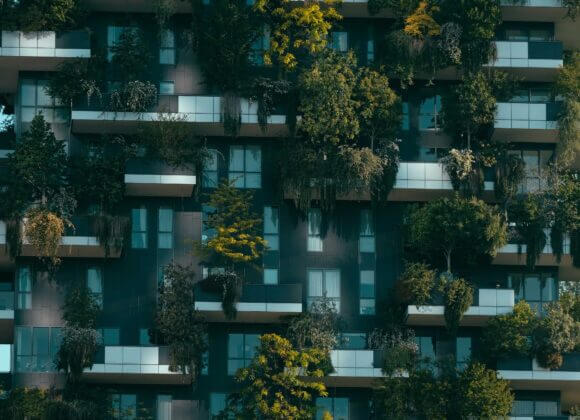Das Thema seniorengerechtes beziehungsweise betreutes Wohnen gewinnt angesichts der demographischen Entwicklung zunehmend an Bedeutung. Denn: Die Österreicher werden immer älter. 2050 werden Menschen über 60 Jahre rund ein Drittel unserer Gesellschaft ausmachen, bis 2080 wird die Anzahl der über 65-Jährigen gar auf 2,17 Millionen steigen. Die demografische Entwicklung fordert aber nicht nur auf den Pflege- und Sozialbereich, sondern auch die Immobilienwirtschaft heraus. Denn erklärtes Ziel der Senioren ist es, möglichst lang selbstbestimmt, gegebenenfalls mit Unterstützung, in den eigenen vier Wänden zu bleiben.
Doch diese sind in der Regel nicht auf die Bedürfnisse, die sich mit zunehmendem Alter und damit verbundenen Einschränkungen ergeben, ausgerichtet. „Aktuell wohnen zwei Drittel der Menschen über 60 Jahre in Wohnungen, die nicht barrierefrei sind. Dort gibt es Stolperfallen wie Türstaffel oder Teppiche“, sagt Franz Kolland, Leiter des Kompetenzzentrums für Gerontologie und Gesundheitsforschung an der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften in Krems. Konzepte für leistbares, altersgerechtes Wohnen zu entwickeln, wird somit in den kommenden Jahren und Jahrzehnten eines der zentralen Themen der Wohnungswirtschaft werden.
Betreutes Wohnen als Alternative
Eines dieser Konzepte ist betreutes Wohnen. Das Interesse daran ist jedenfalls gegeben: Wie die Studie „Wohnmonitor Alter“ der KL Universität Krems zeigt, ist bei einem Wohnungswechsel von Senioren der Umzug in ein betreutes Wohnen mit 39 Prozent am häufigsten. Zusätzlich geben 33 Prozent der Befragten an, dass im Fall des Falles diese Option für sie infrage käme.
Mehrgenerationenhäuser und Alters-WGs werden hingegen von rund der Hälfte der Befragten abgelehnt. „Man hat seine eigene Wohnung, seinen Rückzugsort, aber gleichzeitig die Möglichkeit zu sozialen Kontakten. Darüber hinaus wird man bei vielen Angelegenheiten des täglichen Lebens unterstützt“, beschreibt Kolland, der dieser Wohnform durchaus Potenzial zugesteht.

Was ist betreutes Wohnen?
Unter betreutem, auch betreubarem oder begleitetem Wohnen werden grundsätzlich kleine (ca. 45-65m² große), seniorengerechte, barrierefreie Wohnungen in überschaubaren Häusern verstanden, die von gemeinnützigen Bauvereinigungen oder privaten Bauträgern unter Einbeziehung von Wohnbauförderungsmitteln meist in zentralen Lagen errichtet werden. Ergänzt wird das Raumangebot durch Gemeinschaftsräume, eventuell Freiflächen – und Betreuungsangebote verschiedener Anbieter wie unter anderem dem Roten Kreuz, dem Hilfswerk, der Diakonie oder der Caritas.
Wie genau die Betreuung letztlich aussieht, ist mangels konkreter Definition jedoch höchst unterschiedlich. Die Bandbreite reicht je nach Anbieter von kleinen Dienstleistungspaketen über die Unterstützung durch Sozialbetreuungsberufe bis zur Anbindung an ein Pflegeheim. Betreute Wohnungen werden ganz normal angemietet. Für die Unterstützung wird jedoch neben dem Mietvertrag eine gesonderte Betreuungsvereinbarung abgeschlossen.
Welche Pflegestufe braucht man für betreutes Wohnen?
Wer in einen betreute Wohnhausanlage einziehen will, muss bei den meisten Anbietern nicht pflegebedürftig sein. Eine Pflegestufe braucht es daher nicht. Manche Anbieter wie der Fonds Soziales Wien allerdings setzen für eine Aufnahme in ein Betreutes Wohnen-Haus die Pflegebedürftigkeit im Sinne der Pflegegeldgesetze, aber keinen Bedarf an einer „Rund-um-die-Uhr-Betreuung“ voraus.
Was kostet betreutes Wohnen?
Die Kosten für die betreuten Wohnungen richten sich grundsätzlich nach der Größe der Wohnungen. Wurden Wohnbauförderungsmittel für den Bau des Hauses verwendet, sind die Mieten durch die jeweiligen Landesvorschriften reguliert. Die Kosten für die Betreuung variieren je nach Anbieter und Betreuungspaket.
In manchen Bundesländern, wie etwa der Steiermark, werden allerdings sozial gestaffelt bis zu 100 Prozent der Betreuungskosten vom Land Steiermark und den Gemeinden übernommen – vorausgesetzt, mit dem Dienstleistungsanbieter besteht ein Betreuungsvertrag.
In Wien ist es so, dass die Kosten vom Fonds Soziales Wien (FSW) kalkuliert werden. Sie richten sich nach Einkommen und Pflegegeldbezug und sind sozial gestaffelt. Welchen Kostenbeitrag Sie zu entrichten haben, liegt also an der Höhe ihres Nettoeinkommens, Pflegegeldes und Vermögens.
Wie kommt man in ein betreutes Wohnen?
Am sinnvollsten ist es, sich mit Bauträgern, die in der Region betreute Wohnungen anbieten, in Kontakt zu setzen. Auch Gemeinden wissen über entsprechende Angebote Bescheid. Im Übrigen muss man über 60 Jahre alt sein. Wurde das Haus mit Wohnbauförderungsmitteln errichtet, müssen die entsprechenden Voraussetzungen dafür erfüllt werden.

Franz Kolland ist Soziologe und Altersforscher. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der quantitativen Soziologie und der sozialen Gerontologie mit dem Fokus auf Bildungs- und Kulturforschung im Alter, Gesundheit und Pflegeversorgung, ältere Beschäftigte und neue Technologien.
Ähnliche Beiträge:
Altersgerechtes Wohnen: So machen Sie Ihr Haus zukunftssicher